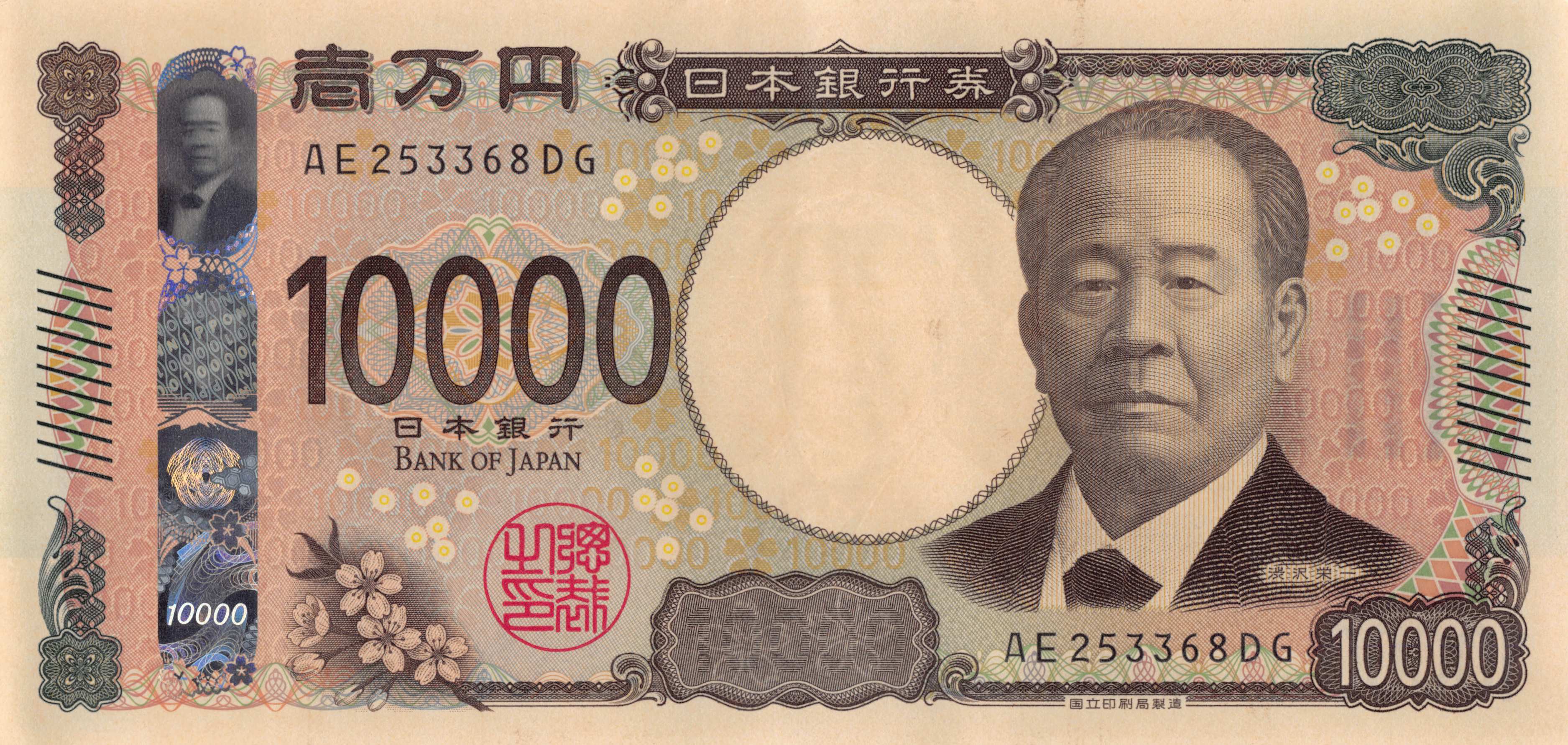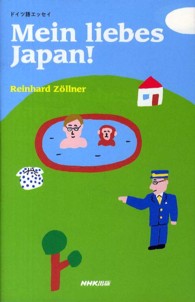War es der Frust über das bislang wenig befriedigende Abschneiden deutscher Athleten bei den Olympischen Spielen in London, der dem FAZ-Redakteur Christian Eichler die Feder führte? Oder reiht sich sein Artikel „Olympias neue Macht: Die Spiele Asiens“ in der FAZ vom 3.8.2012 nur ein in die immer wieder einmal aufblitzende anti-asiatische Grundhaltung dieses ehemaligen Flaggschiffs des bildungsbürgerlichen Denkens in Deutschland? Jedenfalls darf der Artikel künftig in keinem Lehrbuch der Gelben Gefahr fehlen: Er ist ein Musterbeispiel für das verquere Anrühren von Klischees, Vorurteilen und Konstruieren von Zusammenhängen, die überhaupt nicht zusammengehören.
Der staunende Leser erfährt nämlich, daß die Olympischen Spiele, einstmals eine Erfindung Europas, heute fest „in asiatischer Hand“ seien. Und zwar nicht nur wegen der sportlichen Siege asiatischer („fernöstlicher“) Sportler: „Immer waren sie auch ein wenig skandalös.“
Dazu zählt der Journalist die Schiebungen im Badminton (als hätte es den „Nichtangriffspakt von Gijón“ nie gegeben). Dazu zählt er die fabelhaften Leistungen der jugendlichen Schwimmerin Ye Shiwen. Dazu zählt er auch die Leistungen des sehbehinderten Bogenschützen Im Dong-hyun.
Hinter allem steckt ein „verstörendes“ System, befindet der Journalist:
Verstörend auf Europäer wirkt das Gefühl, dass Asien in dieser Hinsicht Vorteile haben könnte: aus einer Tradition der Genügsamkeit und Leidensfähigkeit heraus; der Unterordnung des Einzelnen unter den Willen des Kollektivs. Ebenso aber auch wegen der skrupellosen Macht östlicher Regime über Körper und Köpfe ihrer Athleten.
Offenbar war die DDR ein Teil Asiens. Abgesehen davon, daß es dem Leser die Schamröte ins Gesicht treiben muß, wenn demokratische Staaten wie Südkorea, Taiwan, Indien und Japan mit China in einen Topf geworfen werden. Der Verfasser unterstellt, es gebe „ein asiatisches System, darauf ausgelegt, sich nicht gegenseitig zu schlagen, solange es noch Europäer zu schlagen gibt“. Ein Blick auf die Ergebnisse in einer asiatischen Sportart wie Judo zeigt, welchen Grad an selektiver Wahrnehmung man erreicht haben muß, um so etwas in einer deutschen Zeitung zu behaupten.
Der Autor bedauert im gleichen Atemzug die „Gesichtslosigkeit asiatischer Leistungskraft“; gegen die
regt sich beim westlichen Betrachter gern innerer Widerstand gegen die Bewunderung der Leistung. Ihn irritiert, dass der Mensch, der sie erbringt, nicht zu leiden scheint dabei.
Asiatische Sportler wirken auf den weißen Journalisten wie ferngesteuerte Automaten, die unfähig zu echten Emotionen sind. Nur die Niederlage der Fechterin Shin A-lam, ihre (geisha-gerechte) „sanfte Verzweiflung“ hat für Eichler Asien „ein menschliches Gesicht“ gegeben.
Offenbar hat der Journalist keine Vorstellung davon, wie Sportler in Japan, China, Korea usw. trainieren. Er schreibt aus der Pose des britischen Kolonialoffiziers, der sich in Delhi darüber wundert, daß seine indischen Boys fünf Finger an der Hand haben, um einen Cricket-Schläger zu halten. Oder zeitgemäßer: ein Badminton-Racket.
Nun sieht Eichler die olympischen Ideale durch das Erwachen Asiens in Gefahr. White Man’s Burden also. Unfaßbar, aber es paßt zu meinem Bild des deutschen Qualitätsjournalismus: dieser Orientalist in Diensten der FAZ hat bereits zweimal den Fair-Play-Preis für Sportjournalismus erhalten. Wahrscheinlich wurde er von Rudyard Kipling gestiftet.