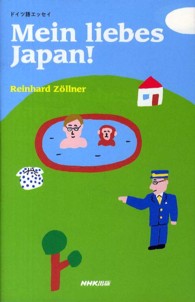Der 31. März ist in Japan für die meisten Unternehmen (und auch den Staat) Ultimo — das Ende des Geschäftsjahres und damit auch die letzte Chance, wichtige Informationen über den Gang der Geschäfte zu offenbaren. In mehreren spektakulären Fällen ist dies 2017 so gründlich danebengegangen, daß man froh sein dürfte, wenn endlich der 1. April da ist. Jedenfalls diejenigen Unternehmen, die den Schnitt überstehen werden.
Ganz open auf der Skandalliste steht natürlich Tōshiba 東芝, ein Riese der japanischen Elektro- und Elektronikbranche. Die Firmengeschichte reicht bis 1875 zurück, doch erst während des Zweiten Weltkrieges wuchs das Unternehmen zu einem Global Player, der sich auch in der Computerindustrie einen Namen machte. Tōshiba stieg auch in die Atomindustrie ein und verantwortete (zunächst als Lizenznehmer amerikanischer Partner) den Bau u.a. von Reaktoren in Fukushima II. 2006 kaufte es schließlich die Atom-Sparte von Westinghouse und wurde damit zum weltweit größten AKW-Bauer. Die Hoffnung war, Aufträge für den Neubau der in die Jahre gekommenen Atommeiler in aller Welt akquirieren zu können. Selten ist ein Geschäft so in die Hose gegangen wie dieses: Nach der Havarie von Fukushima II wurden weltweit Neubaupläne storniert oder die Sicherheitsanforderungen derart verschärft, daß Tōshibas Aussichten auf Gewinn verpufften. Nun hat man Westinghouse pleite gehen lassen. Schon 2015 geriet das Unternehmen in eine schwere Krise, als sich herausstellte, daß man jahrelang Bilanzen geschönt hatte. Die Folge waren ein Verlust von Tausenden von Arbeitsplätzen und der Verkauf der Sparten für Medizin und Haushaltsgeräte.
Für das nun endende Geschäftsjahr meldet Tōshiba einen Verlust von mehr als 8 Mrd. Euro an. Nun soll, um die Verluste aus der Atomwirtschaft zu decken, auch noch die lukrative Halbleiter-Sparte zum größeren Teil veräußert werden. Was dann von einem stolzen Unternehmen noch bleibt, sind Aufzüge, Klimaanlagen und ähnliches Kleinvieh … und Aufräumarbeiten in japanischen Kernkraftwerken. Eines der nicht ganz seltenen japanischen Unternehmen, das von seinen eigenen Managern in den Sand gesetzt wurde (so auch Sharp, das 2016 zu zwei Dritteln an das taiwanische Foxconn verkauft werden mußte). Auch für Deutschland wird Tōshibas Niedergang übrigens Konsequenzen haben: Die Standorte in Neuss, Düsseldorf und Mannheim (Westinghouse) sind in die betroffenen Sparten involviert.
Die Dimension ist erheblich geringer, aber die japanischen Gemüter erregt in diesen Tagen auch die Insolvenz von Tellme Club, einem Anbieter von Billigreisen. Am 27.3. stellte das Unternehmen abrupt seine Tätigkeit ein. Das Geld für 26.000 bereits gebuchte Touren — rund 82 Mio. Euro — blieb es seinen Partnern schuldig. Mehr als 50 Hochschulabsolventen, denen es Arbeitsplätze ab dem 1. April zugesagt hatte, stehen nun vor dem Nichts. Abgesehen von den geplatzten Reiseträumen vieler erboster Kunden … Aber gesamtwirtschaftlich, wie gesagt, sind das Peanuts.
Ein anderes Energieunternehmen, nämlich Kansai Electric Power (Kepco), hat zugegeben, 22.400 Mitarbeitern Entlohnungen für Überstunden in Höhe von fast 14 Mio. Euro schuldig zu sein. Das Geld soll im April nachgezahlt werden. Nun wird dies Kepco gewiß nicht in die Insolvenz treiben. Doch beim Thema Überstunden wird in Japan zur Zeit sehr empfindlich reagiert, seitdem im Dezember 2016 der Präsident der Werbeagentur Dentsū seinen Hut nehmen mußte, weil eine 24-jährige Mitarbeiterin zu Weihnachten 2015 vom Dach ihres firmeneigenen Wohnheims gesprungen war. In den 8 Monaten seit ihrem Eintritt in die Firma hatte sie Monat für Monat mehr als 100 Überstunden leisten müssen …
Schließlich noch ein Skandal mit politischen Folgewirkungen. Eine Privatschule in Ōsaka hat sich mit falschen Angaben über die Kosten eines geplanten Schulbaus staatliche Beihilfen erschwindelt und muß diese nun zurückzahlen. Den Bauunternehmer hatte der Schulleiter dazu gebracht, drei verschiedene Kaufverträge mit unterschiedlichen Baupreisen aufzusetzen, damit er die Förderstellen täuschen konnte. Die wirklichen Kosten beliefen sich auf rund 13 Mio. Euro, Stadt und Staat wurde nur die Häfte genannt. Aber der erschwindelte Zuschuß ist nur die Spitze des Eisberges. Das Grundstück, auf dem die neue Schule gebaut wird, gehörte nämlich ursprünglich dem Staat und wurde vom Finanzministerium für einen Bruchteil des offiziellen Preises an die Schule verschleudert. Besonders anrüchig ist dabei, daß der Schulleiter Leiter der lokalen Organisation des Nippon Kaigi 日本会議 ist, eines nationalistischen Verbandes, dem weite Teile der japanischen Regierung (darunter auch Finanzminister Asō Tarō 麻生太郎 und Premierminister Abe Shinzō 安倍晋三) sowie der Parlamentsabgeordneten der Liberaldemokratischen Partei nahestehen. Zum Programm dieser Truppe gehören die Änderung der Verfassung einschließlich des Friedensartikels 9, ein Shintō-Revival und eine stramm nationalistische Erziehungspolitik … Vorgelebt hat die Privatschule dieses Programm bereits in ihrer seit einigen Jahren betriebenen Grundschule, in der die Kinder u.a. Militärmärsche und den knochenkonservativen Kaiserlichen Erziehungserlaß von 1890 auswendig lernen müssen. Im Zusammenhang mit dem Bauskandal in Ōsaka ist dies alles ans Licht gekommen und hat ungläubiges Entsetzen bei den meisten Japanern ausgelöst. Verstärkt noch durch die Tatsache, daß die Frau des Premierministers, begleitet von Regierungsbeamten, im Kindergarten als Rednerin auftrat, dessen Erziehungsziele hoch lobte und — jedenfalls behauptet dies der Schulleiter — eine beachtliche Geldspende leistete. Abe und seine Frau streiten dies vehement ab, weil ihre Verwicklung in diese Affäre politisch gefährlich ist. Die Opposition im Parlament, aber auch die Präfektur Ōsaka haben hier einen Hebel entdeckt, um dem ultrakonservativen Netzwerk am Zeug zu flicken, das Abe und seine Freunde seit Jahren aufbauen. Abe hat sogar seinen Rücktritt für den Fall angeboten, daß ihm eine Einflußnahme auf den Schulbauskandal nachgewiesen wird …
Die Japaner sind jedenfalls mißtrauisch geworden. Die Popularität Abes hat laut Umfragen wegen dieser Affäre spürbar nachgelassen. Und die Schule, die ab dem 1. April eigentlich ihren Betrieb aufnehmen wollte, hat dafür viel zu wenige Anmeldungen erhalten … noch so ein Verlustgeschäft.
30
Mar 2017