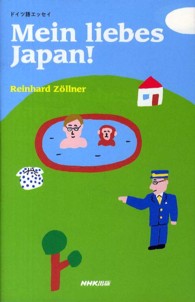Die Stadt Minamisōma 南相馬 in der Präfektur Fukushima 福島 ist Schauplatz des jüngsten Spielfilms von Dorris Dörrie, der den wenig originellen Titel Grüße aus Fukushima trägt (international übrigens angekündigt unter dem noch schlimmeren Titel Fukushima mon Amour).1 Bereits 2008 hatte sich Dörrie in Kirschblüten — Hanami mit Japan befaßt, und die japanische Schauspielerin Irizuki Aya 入月絢, die damals eine tragende Rolle spielte, erscheint auch in Dörries neuem Japan-Film in einer Nebenrolle: sie darf Ukulele spielen, um die Bewohner einer provisorischen Siedlung (kasetsu jūtaku 仮設住宅) zu bespaßen. Es handelt sich um Menschen, die nach dem Tsunami vom 11.3.2011 und dem Reaktorunfall im nahegelegenen Atomkraftwerk Fukushima II ihre Häuser und Wohnungen verlassen mußten und die bis heute weder ein neues Zuhause gefunden haben noch in ihre alte Heimat zurückkehren durften. Ganz überwiegend handelt es sich um Alte, denen Mut, Kraft und Geld fehlen, um noch einmal neu anzufangen.
Um den Lebensmut dieser Menschen zu erhalten, engagieren sich seit 2011 zahlreiche Freiwillige. Zu ihnen gehört auch die Organisation Clowns4Help, die das Konzept des social clowning verfolgt. Ihnen geht es um „resilience through laughter“, und man scheut sich ein wenig, dies ins Deutsche zu übersetzen, denn allzu leicht kommt dabei „Kraft durch Freude“ heraus. So wie bei den Nazis ist es natürlich nicht gemeint; vielmehr geht es darum, bei Menschen, die in kollektiven Krisen stecken, Lebensmut zu mobilisieren.
Pech nur, wenn die Clowns, die dies vermitteln sollen, selbst in einer Krise gefangen sind. Genau darum geht es in diesem Film. Die junge deutsche Heldin mit dem programmatischen Namen Marie (Rosalie Thomass) hat sich ihre eigene Hochzeitsfeier vermasselt und flieht vor sich selbst nach Fukushima, weil sie hofft, dort auf Menschen zu treffen, die noch unglücklicher sind als sie selbst. Sie tritt dort auf wie der sprichwörtliche Elefant im Porzellanladen, bis sie Momoi Kaori 桃井かおり begegnet, einem richtig großen Namen des japanischen Filmgeschäfts. Deutsche Kinogänger kennen sie mindestens aus Kurosawas Kagemusha (1980). Unter Dörries Regie spielt Momoi „die letzte Geisha“ des Ortes, die mit Hilfe von Marie in ihr vom Tsunami zerstörtes Haus zurückkehrt. Es stellt sich heraus, daß die junge Deutsche und die alternde Japanerin beide von bösen Geistern heimgesucht werden: Schuldgefühle belasten sie so stark, daß sie kurz vorm Selbstmord stehen. Erst im gemeinsamen Umgang mit ihren Erinnerungen (Gespräche kann man das kaum nennen, denn es reicht auf beiden Seiten nur für holpriges Englisch) überwinden sie die Vergangenheit. Nebenbei lernt die Deutsche ein paar grundlegende Benimmregeln (wie man anständig sitzt) und wie man eine Tasse Tee genießt, was durchaus klischeehaft und wie ein Zitat aus Arnold Fanks Die Tochter des Samurai wirkt. Ruth Eweler, die deutsche Hauptdarstellerin von 1937, war damals übrigens genauso blond wie Rosalie Thomass heute und hatte auch genauso viel Angst vor Erdbeben, und der Buddhismus mußte schon damals dafür herhalten, um solche Ängste zu beruhigen.
Genau wie Eweler seinerzeit der Versuchung widerstand, in Japan zu bleiben, kehrt auch Thomass am Ende in ihre Heimat zurück. Eine weitere, sicher nicht zufällige Parallele: Dörries Film ist komplett in Schwarz-Weiß gehalten.
Trotz aller Klischees ist der Film unterhaltsam, stellenweise dank der großartigen Momoi sogar amüsant. Daß er im Übermaß sozialkritisch wäre, kann man wirklich nicht behaupten. Es geht um zwei Protagonistinnen, deren Krisen letztlich selbstverschuldet sind.
Radioaktivität kommt zum Glück nur kleindosiert vor (wiederum klischeehaft, aber vielleicht nicht ohne Realitätsbezug: die Deutsche mißt am Anfang panisch die Strahlenbelastung in der Luft), der Bezug zum Atomkraftwerk wird lediglich im Abspann wie eine Pflichtübung durch einige Standbilder von Anti-Atomkraft-Demonstrationen hergestellt. Einige dramatische Sequenzen bringen dagegen den großen Tsunami von 2011 ins Bild, dessen Verwüstungsspuren bis heute erhalten sind.
Es ist sicher kein sonderlich tiefschürfender Film, der unsere Sicht auf die japanische Welt grundstürzend verändern könnte. Ich habe den Kinobesuch dennoch nicht bereut. Er ruft Erinnerungen an 2011 wach, die mir — fünf Jahre nach den Geschehnissen — immer noch nahegehen, und er tut dies dankenswerter Weise ohne den Anspruch, belehren zu wollen. Wenn er eine Botschaft vermitteln will, dann wohl diese: Wir können unser Leid miteinander teilen, wenn wir bereit sind, mit den Augen des Anderen zu sehen.
Anmerkungen
1 Um klarzustellen, worauf sich meine Kritik bezieht: Der Bezug zu Alain Resnais‘ „Hiroshima mon amour“ von 1959 ist mir schon bewußt. Aber es gibt „Fukushima mon amour“ jetzt bereits mehrfach (u.a. das Butoh-Projekt von Endō Takashi, der mit Dorris Dörie wohlbekannt ist, und den Roman von Daniel de Roulet), so daß von „originell“ nun wirklich nicht mehr die Rede sein kann. Der Bezug zum AKW Fukushima erschöpft sich in Dörries Film zudem in symbolischen Bezügen zur Radioaktivität und Hinweisen auf gesperrte Straßen. Nichts davon ist allerdings für die Handlung wesentlich.