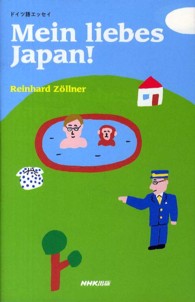Als wären die chinesischen Provokationen im Streit um die Senkaku-Inseln nicht schon schlimm genug, müssen sich die Japaner jetzt auch noch über die oberlehrerhaften Kommentare der deutschen Presse ärgern. Ganz vorn dabei wieder einmal die FAZ, deren Kommentator Carsten Germis am 21.9. seinen Lesern beibringt:
Mehr als 200 Jahre war das Land unter der Herrschaft der Shogune des Tokugawa-Clans, deren Regierungszeit Edo-Zeit genannt wird, von der Welt abgeschottet. Erst Ende des 19. Jahrhunderts kam es unter dem Druck amerikanischer Kanonenboote zur Öffnung. Bis heute hat sich aller oberflächlichen Modernisierung zum Trotz viel von dieser feudalen Kultur der Edo-Zeit unterschwellig in der japanischen Gesellschaft erhalten. Es gibt ein starkes Gefühl, anders und besonders zu sein. Eine schwere Sprache, ein dichtes soziales Regelwerk, das den Umgang miteinander bestimmt, das Bewusstsein eines lange abgeschotteten Inselvolks, etwas Besonderes zu sein, nährt den Nationalismus, vor allem dann, wenn der Druck von außen auf Japan immer stärker wird.
Schuld an dem jetzigen Konflikt sind also die Tokugawa; dann die Amerikaner, die Japan offenbar traumatisiert haben; dann die Japaner, die sich nur oberflächlich modernisiert haben; und nicht zuletzt die „schwere Sprache“.
Die schwere Sprache. Allein diese Behauptung disqualifiziert einen Japan-Korrespondenten eigentlich hinlänglich. Aber spinnen wir den Gedanken weiter: Hätte Japan eine so leichte Sprache wie Deutsch, dann hätte es sich natürlich tiefgründig modernisiert, hätte nie einen Zweiten Weltkrieg begonnen und 6 Millionen Juden vernichtet.
Habe ich die FAZ jetzt richtig verstanden?